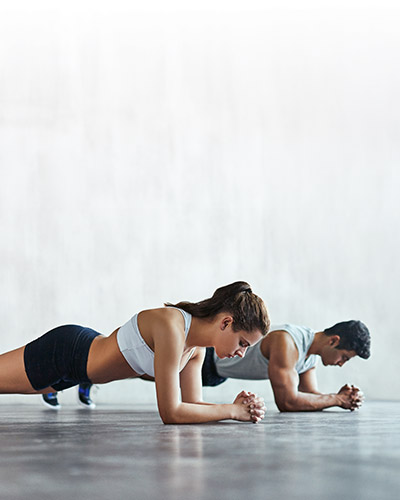Prioritäten
Lebenstiefen – Belastung oder Bereicherung?
Vor acht Jahren zog mein Körper die Notbremse. Burnout. Plötzlich stand alles still. Schnell ging nicht mehr. Mühsam und mit vielen Rückschlägen habe ich ins Leben zurückgefunden. Wie gehen wir mit Krankheiten und dadurch entstehenden Sorgen um?
Stephanie Kelm
Autorin und Lektorin
Kaum erholt ...
Krebsdiagnose
Fünf Jahre nach dem Burnout erfülle ich mir einen Traum: Ich wandere fünf Wochen zu Fuß allein über die Alpen. Was mir in den Alpen gelingt, bleibt im Alltag eine Herausforderung. Die Stunden bei meiner Psychotherapeutin haben eine gute Grundlage gelegt. Im praktischen Leben fällt es mir aber immer noch schwer, Nein zu sagen, mich abzugrenzen, zu entspannen, «weniger ist mehr» zu leben.
Zwei Jahre nach meiner Alpenüberquerung sitze ich im Brustzentrum und erhalte die Diagnose Krebs. Ich frage mich: Was will mir mein Körper damit sagen? Dass ich sieben Jahre nach meinem Burnout mit Brustkrebs dasitze, trifft mich mehr, als ich zunächst meine.
Burnout: Ich muss auf meinen Körper hören
Die Diagnose Brustkrebs ist für mich erst einmal kein so tiefer Einschnitt ins Leben, wie mein Burnout es war. Damals war ich von einem Tag auf den anderen herausgerissen aus dem Leben. Mein Körper fühlte sich an wie ein PC, der gnadenlos herunterfährt.
Mir war schnell klar: Mein Körper holt sich das zurück, was ich ihm jahrelang nicht gegönnt hatte: Ruhe. Ich war immer auf Zack: organisieren und möglichst effektiv arbeiten, an alles denken, alles mitbekommen – niemanden übersehen, niemanden enttäuschen.
So habe ich als Frau eines Pastors, in meinem Job als Redakteurin und in sämtlichen Beziehungen funktioniert. Irgendwann hatte ich das Gefühl, mich zu zerreißen und doch niemandem gerecht zu werden. Die Krankheit war Denkzettel und Befreiungsschlag. Plötzlich musste ich nichts mehr.
Die Ungeduld saß mir dennoch in den Knochen. Das Nichts-tun-Können forderte mich heraus. Am Anfang dachte ich noch: Spätestens in einem Jahr bin ich wieder «da». Dann merkte ich jedoch: Meine Rechnung geht nicht auf. Tritte aufs Gaspedal brachten nichts. Wenn sie glückten, bremste mein Körper danach gleich wieder. Beständig erinnerte er mich: Hör auf mich! Es waren Jahre, in denen ich auch den Eindruck hatte: Ich lerne mich endlich kennen. Ich lerne zu sehen, was ich brauche und dass ich brauche. Ich lerne meine Grenzen zu akzeptieren. Ich darf ich sein – introvertiert, sensibel, emotional, ruhebedürftig. Mein Burnout hat mir viele Botschaften gesendet. Und der Krebs?
Brustkrebs: Ich muss
für mich sorgen
Die aktuelle Diagnose konfrontiert mich erneut mit der Frage, was mir eigentlich wichtig ist. Sie hinterfragt meine Art zu leben. Einerseits suche ich nach Hebeln, die ich betätigen kann. Andererseits weiß ich: Ich brauche nicht nur ein Rezept – ich muss nachhaltig Dinge verändern.
Dass ich Krebs habe, kommt lange nicht bei mir an. Trotz fühlbarem Tumor in der Brust fühle ich mich nicht nach Krebs, so sehr mir mein Kopf und die Befunde das auch sagen. Das Einzige, was sich ändert: Ich habe auf einmal viele Arzttermine.
Phasenweise mache ich mich verrückt, dann wieder geht mir die Kraft dazu aus. Ich trauere vor der OP um meine Brust, die nie wieder die alte sein wird. Ich bemitleide mich und bin wütend auf die, die gerade unbeschwert Feste feiern. An anderen Tagen ist mir alles egal, ich ignoriere den Krebs weg, in dessen Blase ich dennoch lebe.
Die gute Prognose, die ich habe, hält mich, macht mir Mut. Wo Hoffnung vorbeiläuft, schnappe ich sie mir, schlechte Nachrichten ziehen mich dennoch herunter. Entziehen kann ich mich dem aber kaum. Ich will meine Krankheit verstehen, lese viel – auch die harten Fakten und Rezidivraten. Früher Brustkrebs ist trotz guter Behandlungsmöglichkeiten tückisch.
Beim Burnout hatte ich mehr Zeit für mich und die Prozesse in mir. Im Nachhinein denke ich: Mein Burnout hat mich auf den Krebs vorbereitet. Manches muss ich im Moment nicht durchbuchstabieren, weil ich es damals gemacht habe. Trotzdem ist alles wieder neu.
Bewusst leben zwischen Angst und Hoffnung
Gerade fahre ich täglich zu Bestrahlungen. Trotz dieser Termine lebe ich im Moment überlegter. Ich gönne mir mehr Waldspaziergänge und handyfreie Zeiten, mache Sport und male, ziehe Sprossen und versuche bewusst, mich zu entspannen. Ich spüre, das tut mir gut. Ich bin dadurch in Verbindung mit mir. Es macht mich hoffnungsvoller.
Meine Krankheit zwingt mich in die Gegenwart. Sie zwingt mich dazu, mich um mich zu kümmern und für mich und meinen Körper einzustehen. Es ist nicht egal, wie ich lebe, davon bin ich überzeugt. Neben all den Therapien, die es sorgsam abzuwägen gilt, gibt es auch vieles, was ich in der Hand habe. Ich bin dem Krebs nicht machtlos ausgeliefert.
In manchen Momenten spüre ich: Alles ist gut. Ja, ich habe Krebs, aber alles ist gut. – Wenn ich abends in den Armen meines Mannes liege, fühle ich mich wunderbar gehalten und beschützt. Auf langen Spaziergängen spüre ich: Hier bin ich richtig. Ich glaube auch an Gott. Trotz aller Fragen erlebe ich, dass ich bei ihm gut aufgehoben bin. Dinge fügen sich, ich begegne den richtigen Ärzten, das Timing passt. Das ist für mich nicht selbstverständlich.
Krankheiten zwingen zum Zuhören. Sie stellen, ohne mit der Wimper zu zucken, knallharte Fragen. Sie lassen keine Ausrede gelten. – Was tut mir wirklich gut?
Ich träume von einem einfachen, überschaubaren und bodenständigen Leben. Zugleich hänge ich manchmal stundenlang am Handy. – Wie bekomme ich das gute Leben hin, nach dem ich mich so sehne? Will ich es wirklich oder warte ich darauf, dass es mir zufällt? Das gute Leben fällt mir nicht in den Schoß. Ich stelle fest, ich muss mein Leben sehr aktiv schützen, muss zu manchen Dingen Nein sagen, so sehr sie mich locken, denn ich weiß: Bald danach werde ich mich darüber ärgern. An manchen Stellen gelingt mir das, an anderen nicht.
Eine Weitwanderung
als Gleichnis
Ich bin auf einer Reise. Auf dem Weg. Meine fünf Wochen Alpenüberquerung zu Fuß sind mir in mancher Hinsicht zum Gleichnis geworden. Ich erinnere mich gerade oft daran und es hilft mir auf meinem Weg mit dem Krebs.
Das größte Learning aus diesen fünf Wochen war für mich, die ich am liebsten alles vorher wissen will: Vorbereitung ist gut und wichtig, und doch sehe ich erst unterwegs, wie es wirklich ist. Die Touren waren immer anders als gedacht – mühsamer, schöner, leichter, langatmiger. Und auch jetzt auf meinem Weg durch den Krebsdschungel merke ich nur im Gehen, was mir wirklich hilft.
Manche Angst vor Therapien samt Nebenwirkungen, die kommen werden, ist noch nicht dran. Alles Schritt für Schritt, nacheinander, in meinem Tempo. Den letzten Berg kann ich erst dann besteigen, wenn die Berge davor bestiegen sind. So komme ich am besten ans Ziel. Geduldig und immer gerade mit dem, was dran ist.
Das liest sich vielleicht weise, die Umsetzung ist aber auch Kampf. Über die Alpen zu wandern, war einfacher. Da zählte irgendwann wirklich nur jeder Tag. Beim Krebs zählt auch das Morgen. Trotzdem spüre ich: Loslassen tut mir gut, wenn es gelingt.
Lebenstiefen und
neue Dimensionen
Krankheiten sind Einschnitte ins Leben, die uns Dimensionen und Tiefen zeigen, die wir sonst nicht sehen würden. Durch meine Krankheiten lerne ich mich kennen. Ich lerne, auf mich zu achten. Ich lerne, Verständnis für andere zu haben.
In den vergangenen Wochen bin ich vielen Menschen begegnet, die schlechtere Prognosen haben als ich. Sind Krankheiten immer eine Bereicherung? Ich wage nicht, das so zu sagen. Krankheiten führen uns auch oft in Grenzbereiche, die uns überfordern.
Den ersten Teil meiner Route bin ich mit den München-Venedig-Wanderern gegangen. Sie haben den wahren Spruch: «Jeder hat seinen eigenen Weg nach Venedig.» – Ja, viele haben einen Burnout, viele haben Brustkrebs. Aber am Ende erlebt jeder seinen Weg auf seine Weise beschwerlich, belastend und bereichernd.
Krankheiten können eine Chance sein. Sie versetzen uns einen Tritt in den Hintern. Sie sagen: «Jetzt kündige endlich!» Oder: «Du musst für dich sorgen!» Und plötzlich tun wir es! Aber Krankheiten sind auch bitter und konfrontieren uns schmerzhaft mit den Grenzen unseres Lebens.
Wenn ich entscheiden könnte, würde ich dann in einem zweiten Leben die Krankheiten «hinzubuchen» oder nicht? Wohl eher nicht. Zumindest den Krebs würde ich stornieren. Und doch führt er mich in eine Tiefe und an Fragen heran, die mich und mein weiteres Leben prägen werden. Nachhaltig und auch positiv.
Weiterlesen ...
Lesen Sie alle vollständigen Artikel in
der Printausgabe des Magazins Leben & Gesundheit.