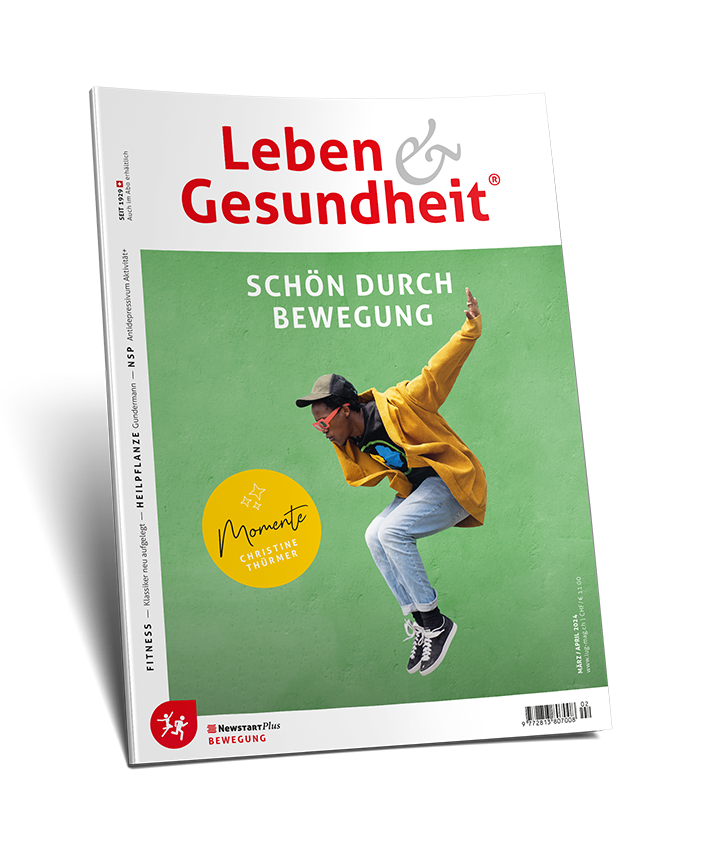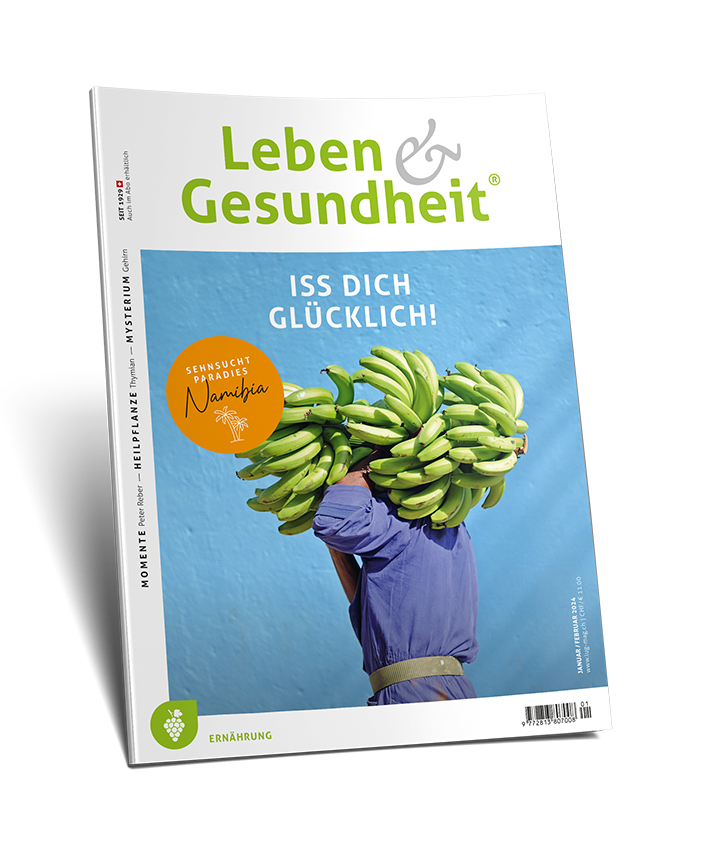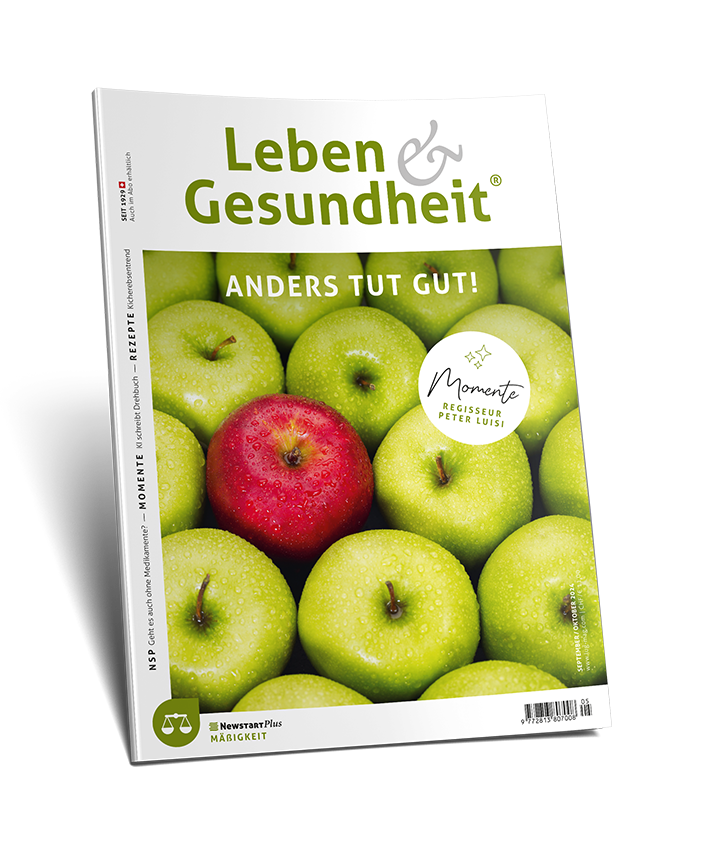Vertrauen
Vertrauen – der Sprung ins Leben
(Ur-) Vertrauen – woher kommt es, wie behalten wir es und was machen wir damit? Kommen Sie mit, um dem Vertrauen auf die Spur zu kommen …
Judith Leitner
BSc Psychologie
An einem schönen Sonntagmorgen geht ein Vater kurz außer Haus, um einige Besorgungen zu machen. Er sagt seinem Sohn, er solle in seinem Zimmer im 1. Stock warten, bis er zurückkomme. Als der Vater nach kurzer Zeit wieder die Einfahrt hochfährt, sieht er mit Entsetzen, dass sein Haus in Flammen steht. Im ersten Stock steht sein Sohn am offenen Fenster und ruft panisch um Hilfe. Der Vater stellt sich schnell unter das Fenster und ruft seinem Sohn zu, er solle sofort springen. Der Sohn zögert, rund um ihn Qualm und Rauch. «Ich sehe dich nicht, Vater». «Das macht nichts, ich sehe dich, das genügt», erwidert der Vater. Der Sohn springt und landet wohlbehalten in den Armen seines Vaters.
Vertrauen kann Leben retten. Aber nicht nur das: Vertrauen macht mutig und befähigt, über die eigenen Grenzen hinauszuwachsen. Vertrauen hat eine viel größere Bedeutung in unserem Leben und Alltag, als wir denken.
Überall ist Vertrauen gefragt
Von Vertrauen ist immer wieder die Rede: in der Arbeitswelt und Wirtschaft, in Beziehungen, in der Familie oder auch im Coaching. Vertrauen bedeutet, sich sicher sein, dass man sich auf jemanden oder etwas verlassen kann. Der Mensch bringt die Fähigkeit, zu vertrauen, schon mit auf die Welt, genauso wie die Fähigkeit zu atmen. Man nennt diese Fähigkeit «Urvertrauen». Es wird nicht erst von Eltern oder ihren Verhaltensweisen erzeugt. Gemäß Viktor Frankl, dem Begründer der Logotherapie, kann es demnach auch nicht zerstört werden.
Selbstverständlich hat aber die Kindheit einen maßgeblichen Einfluss darauf, wie sich das Urvertrauen (weiter-)entwickelt. Das in die Welt mitgebrachte Urvertrauen wird in einem Umfeld der Wertschätzung, Verlässlichkeit und Beständigkeit
bestätigt und gestärkt. Leider gibt es aber auch Situationen, in denen das Urvertrauen in der Kindheit durch desolate Umstände zugeschüttet wird. Dann besteht die wichtige Aufgabe darin, das Urvertrauen wieder auszugraben und zurückzugewinnen. Viktor Frankl betont dabei die «Trotzmacht des Geistes», mit der
jeder Mensch ausgestattet ist. Dies bezeichnet eine Lebenshaltung, die allen Umständen mit einem «Trotzdem» begegnet, ganz im Sinne von Frankls Buch «… trotzdem JA zum Leben sagen», das er im Konzentrationslager verfasste. Heute ist diese Haltung unter dem modernen Fachbegriff Resilienz bekannt.
Vertrauen auf Platz 1 der Resilienz
Die Resilienz ist praktisch unser psychisches Immunsystem, das uns befähigt, Krisen und Konflikte zu meistern. Die Forschung hat sich schon viel mit resilienzstarken Personen auseinandergesetzt und dabei herausgefunden, dass das Vertrauen beziehungsweise der Optimismus an erster Stelle steht.
Die Ratten, die Selbstvertrauen gewinnen
Rudolf Bilz (1898-1976) war ein deutscher Psychiater, der sich mit der psychologischen Beobachtung menschlichen Verhaltens beschäftigte und auch vergleichende Verhaltensstudien an Tieren durchführte. Ihm verdanken wir folgende Erkenntnis:
Ratten können bis zu 80 Stunden schwimmen. Wenn man eine Ratte in einen Wassereimer wirft, der glatte Wände hat, sodass sie nicht entkommen kann, ertrinkt sie jedoch bereits nach 15 Minuten. Der ungewöhnlich schnelle Tod der Ratte ist damit zu erklären, dass sie das Vertrauen auf Rettung verliert und sich selbst aufgibt. Diese Erklärung wird durch weitere Experimente gestützt. Wenn man nämlich einer im Eimer schwimmenden Ratte nach 10 Minuten ein kleines Holzstäbchen hinhält, sodass sie überlebt, schafft sie es beim nächsten Mal, die rund 80 Minuten zu überleben, bevor sie vor Erschöpfung ertrinkt. Dadurch, dass sie einmal erlebt hat, dass Rettung aus «heiterem Himmel» in Form eines Holzstäbchens kommen kann, hofft und vertraut sie darauf bis zum Schluss und hält sich am Leben, solange sie kann.
Dies bestätigt auch die Beobachtung, dass erfolgreich überstandene Notsituationen bei aller Tragik ein Plus haben. Das Vertrauen zu sich und zum Leben ist gewachsen. Das Leben hat es trotz allem gut mit einem gemeint, und die eigenen Bemühungen haben ausgereicht, das «Holzstäbchen» zu ergreifen und der Bedrohung zu entrinnen.
Wie komme ich zu Selbstvertrauen?
Auch wenn wir eine negative Erfahrung als Quelle nutzen können, um neues Vertrauen zu schöpfen, muss man nicht auf eine solche warten, um das Selbstvertrauen zu stärken.
Helfen kann dabei, umsichtig und achtsam mit den verschiedenen Lebenssituationen umgehen zu lernen. Dabei konzentriert man sich bewusst auf die Gegenwart. Der Hader mit der Vergangenheit und die Angst vor der Zukunft rauben uns wertvolle Energie. Energie, die wir im Hier und Jetzt brauchen, um gute Entscheidungen zu treffen.
Selbstvertrauen kann man fördern, indem man sich seine Stärken bewusst macht. Wenn man sich realistische Ziele setzt und diese dann verfolgt, verschafft einem das nicht nur ein gutes Gefühl, sondern bestärkt damit auch das Vertrauen in sich selbst. Ganz praktisch empfehle ich, sich jeden Abend vor dem Schlafen kurz Zeit zu nehmen und eine Sache aufzuschreiben, die man heute gut gemacht hat – wie ein kleines Lob an sich selbst. Auch ein Dankbarkeitstagebuch, in dem man täglich eine Sache oder auch mehrere Dinge notiert, für die man dankbar ist, hilft uns, unser Vertrauen und damit auch unsere Resilienz zu stärken. Elisabeth Lukas schreibt: «Nebenbei eine Anmerkung aus psychotherapeutischer Sicht: Dankgebete sind um
vieles gesünder und empfehlenswerter als Bittgebete. In Bittgebeten schwingt nämlich stets eine leise, unterschwellige Angst mit … Bei Dankgebeten ist das anders. Man kann nicht für nichts danken, also dankt man für etwas Bestimmtes. Und zwar für etwas Wundervolles, Beglückendes. Und dies erweitert
das Bewusstsein, dass (auch) etwas Wundervolles und Beglückendes im eigenen Leben vorhanden ist beziehungsweise gewesen ist, und verhindert, es fälschlich als selbstverständlich zu klassifizieren.»
Wie werde ich für andere vertrauenswürdig?
Selbstvertrauen hilft nicht nur uns selbst im Alltag, sondern befähigt uns auch dazu, anderen Menschen positiv zu begegnen und gelingende Beziehungen zu führen. In einer Beziehung ist das gegenseitige Vertrauen die Grundlage. Vertrauen fördert eine offene Kommunikation. Gleichzeitig erweisen wir uns als vertrauenswürdig, wenn wir vertrauliche Angelegenheiten auch als solche behandeln. Vertrauenswürdig ist man auch dann, wenn man Zusagen oder Vereinbarungen einhält. Wenn man authentisch lebt – also Reden und Tun übereinstimmen –, dann wird man von anderen auch als vertrauenswürdig wahrgenommen.
Wie kann ich lernen,
anderen zu vertrauen?
Sich selbst vertrauen, für andere vertrauenswürdig sein – ja, das geht vielleicht alles. Aber anderen vertrauen? Selbst die Kontrolle abgeben? Das kann manchmal richtig schwierig sein. Man hat es aber auch nicht leicht in unserer Welt.
Meine Tochter zum Beispiel hat ein sehr offenes, vertrauensseliges Wesen – schüchtern ist sie selten, auch fremden Personen gegenüber. Eine ältere Dame, der wir beim Spaziergang begegnen, hat natürlich große Freude an diesem «freundlichen Kind». Sobald meine Tochter aber ein gewisses Alter erreicht, muss ich ihr erklären, dass sie fremden Personen nicht einfach vertrauen darf und beispielsweise niemals, wirklich niemals mit jemand Fremdem mitgehen darf. Eine «gesunde» Portion Misstrauen scheint wohl notwendig zu sein, um nicht in Gefahr zu kommen – und das nicht nur im Kindesalter.
Es ist also wichtig, genau nachzudenken, wann Vertrauen anderen Menschen gegenüber angemessen und hilfreich ist, wann es aber auch besser sein kann, Vorsicht walten zu lassen. Oft ist die Rede vom sogenannten Bauchgefühl, ob man jemandem vertrauen kann. Ja, das kann sicher in vielen Fällen helfen. Gleichzeitig ist eine genaue Beobachtung wichtig.
Das Vertrauen in zwischenmenschlichen Beziehungen kann man mit einem großen Glas vergleichen, in das Steine hineingesammelt werden. Nehmen wir an, wir bedecken anfangs gleich den Boden des Glases mit Steinen, sozusagen ein Vertrauensvorschuss und damit eine Vertrauensbasis, auf der man aufbauen kann. Wenn ich erlebe, dass jemand sich vertrauenswürdig verhält, sammle ich Steine in das Glas. Zeigt er unzuverlässiges Verhalten, werden Steine entfernt. Mit der Zeit wird das Glas immer voller oder es wird eben leer – die Vertrauensbasis ist verschwunden. Eine Beziehung kann nur dann gut funktionieren, wenn dieser «Vertrauenstank» immer gut gefüllt ist.
Vertrauen – eine
Entscheidung
Letztlich ist uns das Vertrauen in die Wiege gelegt. Wann und wem wir vertrauen, ist dann aber ganz allein unsere Entscheidung. Ich wünsche Ihnen gute Entscheidungen und ein Leben voller Vertrauen, das sich lohnt!
Weiterlesen ...
Lesen Sie alle vollständigen Artikel in
der Printausgabe des Magazins Leben & Gesundheit.