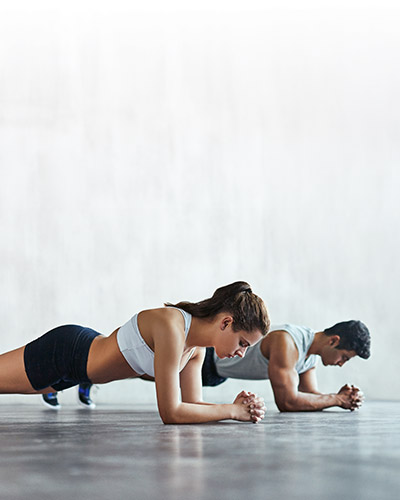Prioritäten
Zeitautonomie und Mobilmanie
Dr. med. Marko Klemenz
Facharzt für Allgemeinmedizin, Notfallmedizin, Suchtmedizin, Diabetologie
und Ernährungsmedizin
Aus unserem Alltag sind sie nicht mehr wegzudenken, die kleinen flachen Geräte, mit denen wir telefonieren, chatten, fotografieren, bezahlen, Filmchen schauen, uns den Weg zeigen lassen, von der Arbeit aus Waschmaschine, Backofen, Heizung oder Jalousien bedienen und in Echtzeit rund um den Globus Freunde und Familie an unserem Leben teilhaben lassen können.
Wie praktisch, einfach und bequem sind viele Sachen dadurch geworden. Die Rede ist vom Smartphone.
Gleichzeitig kann es aber auch vorkommen, dass wir mehr Zeit «am Bildschirm» verbringen, als uns lieb ist (oder wir bereit sind, uns einzugestehen). Lassen wir uns zu leicht durch aufploppende Nachrichten von unserer Arbeit ablenken? Fällt es uns schwer, dem Sog des nicht endenden Stroms von TikTok-Videos oder YouTube-Shorts zu widerstehen?
Die durchschnittliche Smartphone-Nutzung betrug 2020 in Deutschland nach de.statista.com bis zu 230 Minuten täglich, das sind fast vier volle Stunden. 58-, 84-, teilweise über 100-mal wird am Tag das Handy entsperrt. So wundert es nicht, dass der Begriff Smartphone-Sucht (bislang keine offizielle Diagnose) immer mehr in den Mund genommen wird. Selbst die bloße Anwesenheit eines Smartphones auf dem Schreibtisch reduziert nachweislich unsere Leistungsfähigkeit.1 All das ist Grund genug, sich selbstkritisch mit dem Thema auseinanderzusetzen, das eigene Verhalten zu prüfen und gegebenenfalls zu ändern.
Behalte den Überblick
Eine ganz einfache Möglichkeit, sich selber ein Bild über den eigenen Smartphone-Gebrauch zu machen, bietet das Handy selbst. Unter «Einstellungen» gibt es je nach Gerät die Funktion «Digitales Wohlbefinden» oder «Screen Time» (Bildschirmzeit). Hier wird Tag für Tag genau festgehalten, wie oft das Handy entsperrt wurde, wie viele Minuten es insgesamt verwendet wurde und welche Apps wie lange im Einsatz waren. Diese Selbstanalyse kann sehr aufschlussreich sein.
Woher diese Anziehungskraft?
Wie kommt es, dass die Apps und Funktionen des Handys eine so starke Anziehungskraft auf uns ausüben? Viele kluge Köpfe haben sich überlegt, was notwendig ist, damit Benutzer sich möglichst lange mit einer bestimmten App beschäftigen und diese dadurch erfolgreich machen.
B. F. Skinner, ein bedeutender amerikanischer Psychologe des 20. Jahrhunderts, hat den Begriff der operanten Konditionierung – eine Weiterentwicklung der klassischen Konditionierung – geprägt. Bei der klassischen Konditionierung konnte der russische Arzt und Physiologe Iwan Petrowitsch Pawlow zeigen, dass ein normalerweise mit der Fütterung verbundenes Glockensignal später Speichelfluss bei Hunden auslösen konnte, selbst wenn gar kein Futter mehr angeboten wurde. Bei der operanten Konditionierung hingegen wird ein bestimmtes natürliches Verhalten bei Tieren oder Menschen durch positive oder negative Konsequenz gefördert oder gehemmt.
Wenn wir auf Instagram, WhatsApp oder wo auch immer einen Beitrag posten und dafür als Reaktion «Likes», Herzchen, mehr Follower oder einen «thumbs-up» (Daumen hoch) erhalten, nimmt unser Gehirn das durch die Ausschüttung des Belohnungshormons Dopamin und das damit verbundene Glücksgefühl als positive Konsequenz wahr, die unser Verhalten im Sinne einer operanten Konditionierung fördert. Wir wollen diese positiven Verstärker und die damit verbundene Dopaminausschüttung wieder erleben und werden deswegen erneut Zeit und Energie in neue Beiträge investieren. Dieser Effekt kann positiv verwendet werden, wenn wir beispielsweise Sprach- oder Fitness-Apps verwenden, die uns für unser erreichtes Vokabel- oder Bewegungspensum gratulieren und uns dabei helfen, an unserem Trainingsprogramm festzuhalten. Er kann von Anbietern aber auch dazu missbraucht werden, um uns in kostenpflichtige Vollversionen zu locken, die noch mehr Möglichkeiten und mehr Motivation versprechen.
Ein weiterer Trick, der dazu verwendet wird, uns an die Bildschirme zu fesseln oder die «retention rate» (Retentionsrate/Kundenbindungsrate) zu erhöhen, ist das Prinzip der variablen Belohnung oder die Belohnung nach einem variablen Verstärkungsschema. Dieses Prinzip macht sich beispielsweise auch das Glücksspiel zunutze. Der besondere Reiz besteht in der Möglichkeit eines Gewinns – verbunden mit der Ungewissheit, ob man auch wirklich gewinnen wird oder nicht. Selbst konservative Plattformen wie Mediatheken öffentlich-rechtlicher Fernsehsender sortieren ihre Angebote oft um, sodass man nicht sicher sein kann, ob ein Film, eine Doku oder ein Musikbeitrag beim nächsten Anklicken auch noch zu sehen sein wird. Das hat zur Folge, dass man tendenziell eher mehr und länger schaut, nach dem Motto: «Was ich habʼ, das habʼ ich.»
Wenn einem auf YouTube oder TikTok wie in einer Unendlichkeitsspirale ständig etwas Neues und Spannendes angeboten wird, «muss» man immer weiter scrollen. FOMO (Fear Of Missing Out) – die Angst, etwas zu verpassen – treibt uns gnadenlos an.
Eine häufige Reaktion auf all das ist der Totalverzicht, der Boykott, die komplette Abstinenz. Damit verbaut man sich aber die Möglichkeit, die Vorzüge der modernen Technologie zu nutzen. Wo ist die nächste Tankstelle in einer fremden Stadt? Wann öffnet das Museum? Wer singt beim diesjährigen Musikfestival?
Wo liegt das eigentliche Problem?
Der Autor Nir Eyal beschreibt in seinem 2014 erschienenen Bestseller «Hooked – Wie Sie Produkte erschaffen, die süchtig machen» diese oben genannten Mechanismen sehr treffend. 2019 hat er ein weiteres Buch mit dem Titel «Indistractable – Die Kunst, sich nicht ablenken zu lassen» veröffentlicht. Darin stellt er die These auf, dass die digitale Technologie – trotz der Gefahr einer potenziellen Suchtentwicklung – nicht das eigentliche Übel, sondern lediglich ein Symptom eines tieferliegenden Problems, nämlich von Einsamkeit, Langeweile und fehlender Selbstwirksamkeit sei. Ablenkungssucht als Bewältigungsstrategie. Er empfiehlt, sich den verborgenen Schmerz einzugestehen, zu erforschen und sich den wichtigen Fragen des Lebens (zum Beispiel Sinn, Zugehörigkeit, Aufgabe, Ziel) zu stellen.
Bist du Chef?
In dem Beitrag des Mitteldeutschen Rundfunks «Smartphonesucht – was gegen die Abhängigkeit hilft» plädiert Professor Christian Montag von der Uni Ulm nach einer selbstkritischen Bestandsaufnahme für ein Wiedererlangen der verlorengegangenen Kontrolle mit den Worten: «Wir sind Chef!» Wie kann das gelingen?
Die wichtigste Regel besteht darin, gesunde Grenzen zu setzen und unsere Zeit für das zu verwenden, was wir für richtig und wichtig halten. Schritte auf dem Weg dorthin könnten (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) zum Beispiel so aussehen:
- Schaffung klarer Tagesstrukturen mit digitalen Freizonen.
- Lästige Klingeltöne und unnötige Benachrichtigungen abstellen.
- Dem vermeintlichen Druck nicht nachgeben, immer schnell auf Nachrichten reagieren zu müssen.
- Im Berufsleben Zeitblöcke einplanen, in denen elektronische Nachrichten bearbeitet werden.
- Impulsives Verhalten (sofort das Handy checken oder meinen, sofort googlen zu müssen) durch eine Latenz (Reaktionszeit) von einigen Minuten schrittweise abtrainieren. Notfalls besonders zeitraubende und unnötige Apps vom Handy löschen.
- Maximale Nutzungszeiten für einzelne Anwendungen auf dem Handy einprogrammieren.
- Armbanduhr statt Handy für die Uhrzeit verwenden.
- Im Schlafzimmer einen normalen Wecker verwenden und das Schlafzimmer zur handyfreien Zone deklarieren.
Zusammenfassend möchte ich dazu ermutigen, das eigene Konsumverhalten digitaler Technologie mit den unzähligen faszinierenden Möglichkeiten immer wieder einmal selbstkritisch zu analysieren. Ja, es besteht ein Suchtpotenzial und ja, das ist teilweise bewusst so konzipiert und gewollt. Wenn man die zugrunde liegenden Mechanismen kennt, für sich selber sinnvolle und praktikable Regeln festlegt und bedarfsweise immer wieder anpasst, kann man sich seine Autonomie, Kreativität und Produktivität bewahren, ohne auf die Vorzüge und Erleichterungen dieser kleinen Geräte im Alltag verzichten zu müssen.
Quellen: 1 Ward, A. F., Duke, K., Gneezy, A., Bos, M. W. (2017). Brain Drain: The mere presence of onbe’s own smartphone reduces available cognitive
capacity. Journal oft he Association for Consumer Research, 2 (2), 140-154.
Weiterlesen ...
Lesen Sie alle vollständigen Artikel in
der Printausgabe des Magazins Leben & Gesundheit.